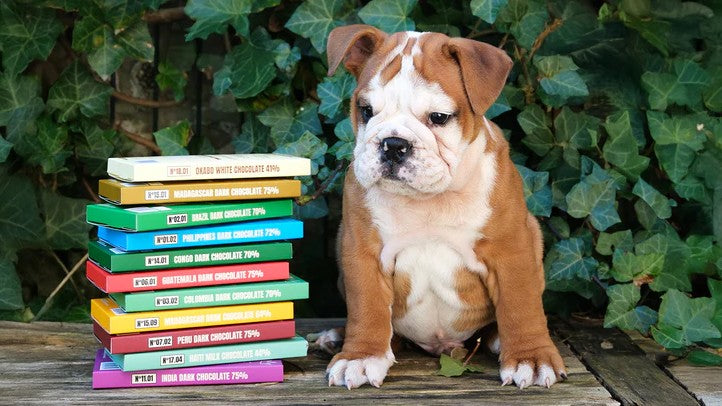Die wichtigsten Änderungen und ihre Auswirkungen auf die Kakaoerzeuger
Stattdessen müssen Erzeuger außerhalb der EU nun die gleichen Standards erfüllen wie europäische Landwirte, die alles von der Fruchtfolge über die Bodenbewirtschaftung bis hin zur Leitung von Bauerngruppen umfassen. Für kleinbäuerliche Kakaoproduzenten in Lateinamerika, Afrika und Asien stellt diese Änderung sowohl eine Herausforderung als auch einen Wendepunkt dar, da die Einhaltung der Standards möglicherweise Umstrukturierungen, Formalisierungen und neue Investitionen erfordert, um auf dem EU-Bio-Markt bestehen zu können.
Was sich ändert und was das für die Kakaoerzeuger bedeutet
1. Ende der Äquivalenz: vollständige Angleichung jetzt erforderlich
- Vorgeschriebene Fruchtfolge und strenge Regeln für die Bodenfruchtbarkeit
- Fortgesetztes Verbot von synthetischen Betriebsmitteln
- Eine strengere Definition der "Produktionseinheit", d.h. der gesamte Betrieb muss nun als ökologisch zertifiziert sein
➤ Auswirkungen
Diese Umstellung trifft Kleinbauern am stärksten. Viele Landwirte, die in der Agroforstwirtschaft oder in gemischten Betrieben arbeiten, müssen feststellen, dass Praktiken, die einst im Rahmen lokaler Standards akzeptiert wurden, nicht mehr zulässig sind. Um ihren Zugang zum EU-Bio-Markt zu behalten, müssen sie ihre Produktionsmethoden anpassen - ein kostspieliger und komplexer Prozess - oder sie riskieren, ganz zu verlieren.
2. Wer darf sich zertifizieren lassen? Neue Beschränkungen für Zertifizierungsinhaber und Gruppenmodelle
A. Nur Genossenschaften und Erzeugergemeinschaften können Zertifikate halten
Private Unternehmen dürfen keine Bio-Zertifikate mehr im Namen von Landwirten halten. Stattdessen muss die Zertifizierung bei Genossenschaften oder gesetzlich anerkannten Erzeugerverbänden liegen. Dies stellt eine grundlegende Abkehr vom bisherigen System dar, bei dem häufig Exporteure oder Sozialunternehmen die Zertifizierung verwalteten und die Lieferketten organisierten.
➤ Ein Beispiel: Kokoa Kamili, Tansania
Kokoa Kamili, ein bekanntes Sozialunternehmen in Tansania, arbeitet mit Hunderten von Kleinbauern zusammen. Nach dem alten Modell konnte das Unternehmen selbst das Bio-Zertifikat erhalten. Nach den neuen Vorschriften musste es seinen Bauern helfen, eine formelle Vereinigung mit Rechtsstatus und Verwaltungsstrukturen zu gründen. Das bedeutete zusätzlichen Zeitaufwand, finanzielle Ressourcen und administrative Unterstützung - eine große Herausforderung in Regionen, in denen die Genossenschaftstraditionen schwach sind oder die Landwirte nur begrenzten Zugang zu rechtlicher und organisatorischer Unterstützung haben.
➤ Auswirkungen
Für viele kleinbäuerliche Gemeinschaften erhöht sich durch diese Änderung die Eintrittsbarriere. Die Bildung und Verwaltung von rechtskonformen Gruppen erfordert Kapazitäten, Schulungen und Ressourcen. Ohne starke organisatorische Unterstützung laufen die Erzeuger Gefahr, vom EU-Bio-Markt ausgeschlossen zu werden.
B. Strengere Regeln für die Gruppenzertifizierung
Die Gruppenzertifizierung war lange Zeit das Rückgrat der Beteiligung von Kleinbauern am Bio-Kakaomarkt. Sie ermöglichte es Tausenden von Kleinbetrieben, die Kosten für die Einhaltung der Vorschriften unter einem Dach zu teilen. Doch mit der neuen Verordnung werden die Regeln viel strenger:
- Maximal 2.000 Erzeuger pro zertifizierter Gruppe. Zuvor konnten Genossenschaften Tausende von Landwirten unter einem Zertifikat zusammenfassen. Jetzt müssen die Gruppen in kleinere Einheiten aufgeteilt werden, was die administrative und finanzielle Belastung durch die Zertifizierung vervielfacht.
- Keine "gemischten Betriebe" mehr. Der gesamte Betrieb wird jetzt als eine einzige Produktionseinheit betrachtet. Die Landwirte können nicht mehr auf einer Parzelle Bio-Kakao und auf einer anderen konventionelle Pflanzen anbauen. Jedes Feld muss biologisch sein.
➤ Ein Beispiel: Peru
Viele peruanische Kakaobauern bauen neben Kakao für den Export auch Grundnahrungsmittel wie Mais oder Reis für ihre Familien und den lokalen Markt an. Selbst ohne Kontaminationsrisiko müssen diese Landwirte nun entweder ihr Land in getrennte juristische Einheiten aufteilen oder den Nicht-Kakaoanbau ganz aufgeben. Beide Optionen sind kostspielig und komplex, und für einige ist eine Bio-Zertifizierung einfach nicht mehr machbar.
Einzelaudits für größere Betriebe. Jeder Betrieb, der größer als 5 Hektar ist oder mehr als 25.000 Euro Umsatz macht, kann nicht mehr in einer Gruppe bleiben. Stattdessen müssen sie sich einer vollständigen Einzelprüfung unterziehen.
➤ Fallbeispiel: Dominikanische Republik
Bei internationalen Kakaopreisen zwischen 8 und 12 US-Dollar/kg überschreiten viele dominikanische Bauern leicht die Umsatzschwelle von 25.000 Euro. Die Kosten für ein individuelles Audit übersteigen oft die Bioprämie, was die Zertifizierung finanziell unattraktiv macht und die Bauern vom Biosystem wegdrängt.
➤ Auswirkungen
Für Kleinbauern bedeuten diese strengeren Vorschriften eine doppelte Belastung: höhere Kosten und strengere Beschränkungen bei geringerem Nutzen. Für einige Gemeinden ist die Beibehaltung des ökologischen Landbaus gemäß den EU-Vorschriften möglicherweise wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll, wodurch das Angebot für den hochwertigen europäischen Schokoladenmarkt schrumpfen könnte.
➤ Gesamtauswirkungen
Die neuen Vorschriften erhöhen den Verwaltungs- und Befolgungsaufwand für die Kakaoerzeuger erheblich. Einige können die notwendige Umstrukturierung in legale Erzeugergemeinschaften oder kleinere Gruppen bewältigen, aber für andere könnten die Änderungen eine Sollbruchstelle darstellen. Kleinbauern, insbesondere in Ländern ohne starke Genossenschaftssysteme oder mit unterschiedlichen Anbaumethoden, laufen Gefahr, ganz aus dem Biosektor verdrängt zu werden, was die Verfügbarkeit von zertifiziertem Kakao für den EU-Markt verringern könnte.
3. Drei Jahre, bevor Sie biologisch sind: die neue Übergangsregel
➤ Zu den Auswirkungen gehören:
- Eine viel höhere Hürde für neue Landwirte oder Regionen, die hoffen, in den Öko-Markt einzutreten
- Erzeuger, die gezwungen sind, in den Übergangsjahren ökologische Praktiken zu befolgen, ohne Öko-Prämien zu erhalten
- Eine geringere Kapitalrendite, was die Ausweitung des ökologischen Kakaoanbaus behindert
- Agroforstsysteme und Betriebe, die "standardmäßig ökologisch" waren, verlieren ihren schnellen Weg zur Zertifizierung
Kurzum, diese pauschale Regelung macht den Zertifizierungsprozess weltweit einheitlicher, aber auch weniger zugänglich, was das Wachstum neuer ökologischer Kakaoherkünfte möglicherweise bremst.